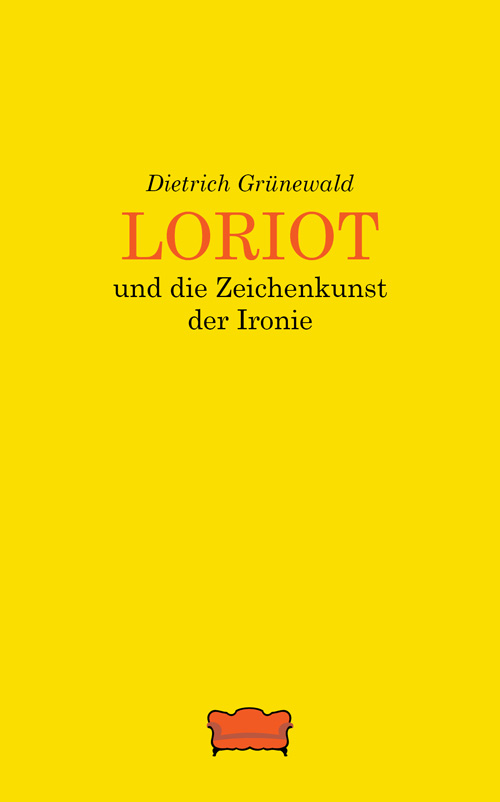Aktuelle Buchempfehlung:
Dem Humor Loriots auf der Spur
Dietrich Grünewald
„Loriot und die Zeichenkunst der Ironie“
Christian A. Bachmann Verlag, Berlin 2019; 175 Seiten; 16 Euro; ISBN 978-3-96234-023-0
In seinem neuen Buch widmet sich Dietrich Grünewald nicht allein Loriots Bildwelten. In loser Reihung führt er durch eine erheiternde Bilderwelt, deren Zusammenhang durch die Anzug und Hut tragenden Knollennasenmännchen entsteht. Das gewählte Kleinformat bedingt mitunter Leseprobleme, wenn in Abbildungen Schrift enthalten ist. Loriots Zeichnungen werden stets einer Vielzahl von historischen Vorläufern bzw. thematisch verwandten Werken anderer Karikaturisten gegenübergestellt. Karikierende Bezüge zu aktueller Kunst sowie die Kritik daran bleiben nicht ausgespart. Grünewald analysiert die humoristischen Strategien und legt so – zur Nachahmung empfohlen – die Wege zum Lachen offen. Hierzu zählt die Provokation des Betrachters, der in vielen „mit despektierlichem Blick“ gezeichneten Bildern seinem eigenen Alltag begegnet, durch ein verstörendes Moment zum Nachdenken, zur Reflektion über sich und seine Gewohnheiten gebracht wird. Das Spiel mit dem Unerwarteten, mit dem Absurden benötigt also den Betrachter als Komplizen, dem unterschiedliche Leistungen abverlangt werden, je nachdem, ob Ein-Bild-Geschichten oder Bildfolgen vorliegen. „Der Künstler ist Herr seiner Bildwelten“, diese entstehen jenseits der empirischen Logik als „Eigenwelt des grafischen Spiels“. Eine beliebte Strategie ist der Rollentausch – Grünewald verweist auf die Möglichkeit diesen im Unterricht vor dem kunsthistorischen Hintergrund der „verkehrten Welt“ etwa der Bilderbögen des 18. oder 19. Jhdts zu entwickeln. Die Beispiele des Rollentauschs, bezogen auf das Geschlechterverhältnis, durchexerziert mit Gartenzwergen oder Tieren haben schlicht Aufforderungscharakter – sie sind wohl bereits fester Bestandteil des kunstpädagogischen Repertoirs. Neben der Fotomontage thematisiert Grünewald die Ergänzung vorgefundener Fotografien durch „mithandelnde“ Comicfiguren; auch dies stellt eine dankbare Aufgabe für den Unterricht dar. Eine Vielzahl aktueller Themen, so die Verspottung politischer Phrasendrescher, die Umweltverschmutzung oder die karikaturhafte Absurdität, zu der das Selbst-Design in Mode und Frisur mitunter führt, wirft nicht nur weitere praktische Aufgabenstellungen für den Unterricht ab, sondern könnte die Hoffnung nähren, eine Erziehung zu Humor sei möglich... Die Erkenntnis, dass ein guter Witz nicht politisch korrekt zu sein hat, mag dabei ein Wegbegleiter sein; Humor „gibt ... mit seiner Kritik am Falschen wichtige Denkimpulse“. Die Kooperation von Zeichner und Betrachter legt fest, was das „Falsche“ ist. In Ergänzung des Tucholsky – Zitates mag festgehalten werden: Kaum reißt jemand einen guten Witz, „dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel“. Wir beobachten, dass kaum noch Witze erzählt werden, der homo oeconomicus zum Lachen in den Keller geht und nur noch der Flachwitz so genannter Comedians Konjunktur hat? D. Grünewald zeigt uns: Humor ist gleichsam didaktisches Material „um das Leben ein wenig besser zu meistern“, mit ihm und durch ihn gelingt somit ein Stück weit fundamentales Lernen für das Leben.